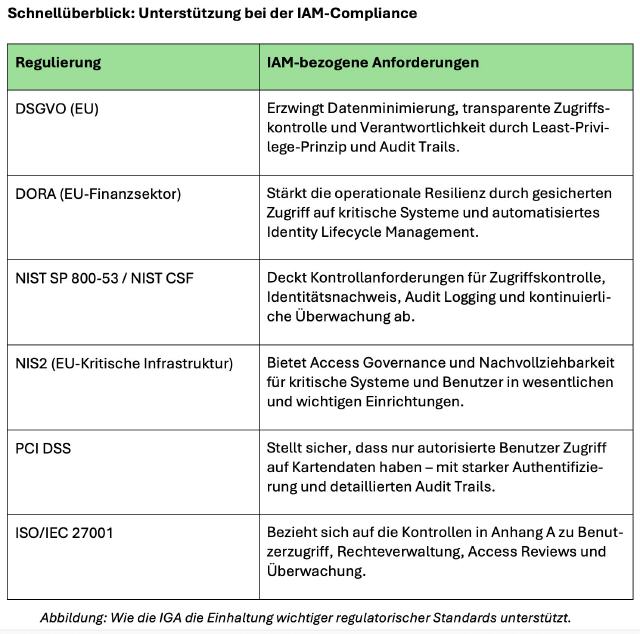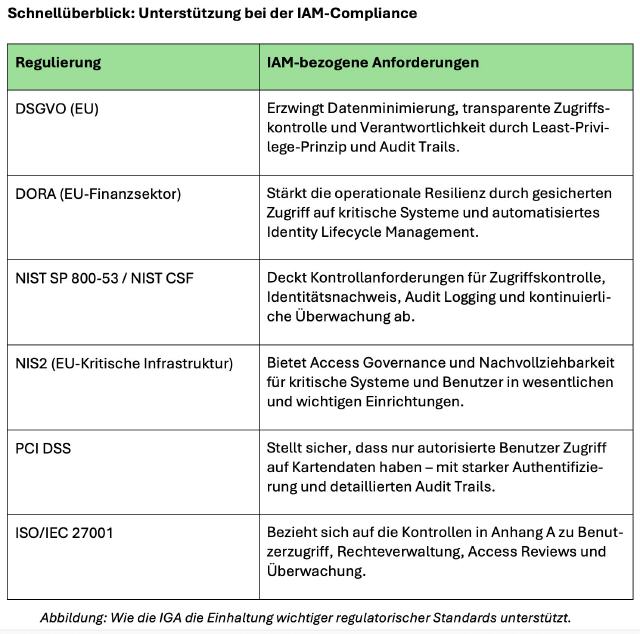Insolvenzverwalter auf dem Prüfstand
Diskussion um Qualitätskriterien und Transparenz bei Insolvenzverwaltern ist bis heute nicht beendet
Qualität bei Insolvenzverwaltern steigern: Vorauswahl und Bestellung von Insolvenzverwaltern sowie Transparenz, Aufsicht und Kontrolle im Insolvenzverfahren

Von Rechtsanwalt Michael Pluta
(24.09.08) - Lange Zeit haben Amtsrichter die Auswahl von Insolvenzverwaltern sehr willkürlich betrieben und sich dabei auf ihre Unabhängigkeit berufen. Bei jedem Gericht bestand ein geschlossener Kreis von Verwaltern. Nachprüfbare Qualitätskriterien gab es nicht.
Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Juli 2006 mit der Feststellung, dass es "Aufgabe der Fachgerichte ist, Kriterien für die Feststellung der Eignung eines Bewerbers sowie für eine sachgerechte Ermessensausübung zu entwickeln", ist diese Praxis nun gestoppt. Seitdem sind viele Amtsrichter ratlos. Während manche das Urteil ignorieren und weitermachen wie bisher, haben viele Amtsrichter in Ratlosigkeit über die zu definierenden Maßstäbe, die Zahl der Verwalter unüberschaubar ausgedehnt, so z.B. in Dresden von 17 auf über 65 Verwalter.
Da das keine Lösung sein kann, haben weitere Gerichte sich daran gemacht, die Auswahl von Insolvenzverwaltern zukünftig nach Qualitätskriterien zu treffen und diese begonnen zu definieren. Um sich nicht haftbar zu machen, müssen sie zukünftig bei Entscheidungen über Millionen-Beträge der Gläubiger Risiken bei der Bestellung des Verwalters minimieren. Dies ist nur möglich, wenn Sie Qualität und Ergebnisse von Verwaltern abfragen. Dadurch werden schwarze Schafe identifiziert und aus dem Markt gedrängt, die den Ruf der Insolvenzverwalter beschädigen. Vorteilhaft ist dabei, dass hohe Anforderungen an Insolvenzverwalter eine Bewerberflut verhindern und den Gerichten eine Vielzahl ablehnender Bescheide ersparen.
Die Diskussion um Qualitätskriterien und Transparenz bei Insolvenzverwaltern, die vor zwei Jahren losbrach, ist bis heute nicht beendet. In der Zwischenzeit haben sich jedoch Arbeitskreise gebildet, die die Entwicklung und Durchsetzung von Qualitätsstandards und Zertifizierungsmodellen für die Bestellung von Insolvenzverwaltern vorangetrieben haben und zu eindrucksvollen Ergebnissen gekommen sind. In der Qualitätsdiskussion hat sich nun jüngst der Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID) zu Wort gemeldet und erst im Juni erklärt, dass die Zertifizierung nach ISO 9001-Norm für alle Mitglieder Pflicht ist. Für Insolvenzverwalter im Wettbewerb um die Besten reicht dies jedoch nicht aus, da die ISO-Norm nur sehr wenige Qualitätskriterien prüft.
Dagegen kann das Rating-Modell des Deutschen Instituts für angewandtes Insolvenzrecht (DIAI), das unter der Leitung von Prof. Dr. Hans Haarmeyer entwickelt wurde, sehr wohl qualitative Aussagen ziehen. Das Modell basiert auf Auswertungen von Kennzahlen von Insolvenzfällen, die für jede Kanzlei berechnet werden können. Die Benotung erfolgt nach Punktzahlen. Daneben werden Daten gesammelt und Durchschnittswerte für alle Kennzahlen über alle geprüften Fälle in den deutschen Kanzleien gebildet. Sie sind die Benchmark, an der sich jede Kanzlei messen kann. Durch dieses Benchmark-Stem hat jeder Verwalter die Möglichkeit, Verbesserungspotenzial zu entdecken und sich im Wettbewerb mit den Besten zu messen.
Parallel dazu arbeitet der Arbeitskreis von Insolvenzrichtern BAKinso an Grundsätzen der Gutachterstellung im Insolvenzeröffnungsverfahren. Viele Amtsgerichte wie in Ulm reagieren aber auch eigenständig und arbeiten eng mit Insolvenzverwaltern zusammen, um Fragebögen an Insolvenzverwalter mit qualitativen Fragen zu ergänzen. Umfassende Fragebögen sollten entlang den Empfehlungen der Uhlenbruck Kommission Qualitätskriterien aufgreifen und weit mehr Informationen bieten als die finanziellen wirtschaftlichen Verhältnissen des Insolvenzverwalters selbst und die Zahl der Mitarbeiter.
So können die Empfehlung der Uhlenbruck-Kommission unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck zur Vorauswahl und Bestellung von Insolvenzverwaltern sowie Transparenz, Aufsicht und Kontrolle im Insolvenzverfahren denn auch als richtungsweisend in der Diskussion um Qualität bei Insolvenzverwaltern angesehen werden. Empfohlen wird zu allererst eine Beschränkung der Vorauswahlliste aufgrund der Anwendung von Qualitätskriterien.
Die Kommission legt zudem einen besonderen Schwerpunkt auf eine Hochschulausbildung mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung und einen Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse im Insolvenzrecht und in der Betriebswirtschaft. Unternehmerische Fähigkeiten, eine entsprechende Büroausstattung und ein hochspezialisierter Mitarbeiterstab gehören ebenfalls dazu. Mit Entschiedenheit weist die Kommission auf die Unabhängigkeit der Verwalter von den Insolvenzverfahren hin.
Sie ist nicht nur in frage gestellt, wenn es sich bei dem Verwalter um eine dem Schuldner nahestehende Person handelt, sondern auch wenn der Insolvenzverwalter den Schuldner beraten oder vertreten hat oder ein beteiligter Großgläubiger durch den Insolvenzverwalter betreut wird. Daneben muss der Insolvenzrichter bereits abgewickelte Fälle nach Erfolgskriterien bewerten. Zusätzlich spielt aber auch die soziale Kompetenz, Erfahrungen im internationalen Insolvenzrecht und Fremdsprachenkenntnisse eine Rolle.
Außerdem weist die Kommission darauf hin, dass die Richter selbst in der Lage sein müssen, Kriterien bei der Beurteilung der generellen Eignung eines Bewerbers einzuschätzen. Dazu gehören neben einer insolvenzrechtlichen Schwerpunktausbildung der Justiz und einer entsprechenden Erfahrung auch eine ausreichende Ausstattung der Gerichte mit einer leistungsfähigen EDV für die Bearbeitung der Verfahren.
Zusammengefasst bieten die Empfehlungen der Uhlenbruck Kommission drei entscheidende Verbesserungsansätze: Neben einem Erhöhen der qualitativen Anforderungen der Insolvenzverwaltungen sollte parallel dazu eine karrieremäßige Aufwertung der Richter und Rechtspfleger bei Spezialisierung im Insolvenzreferat stattfinden. Zudem sind routinemäßige Untersuchungen durch Gerichte, ob die erforderlichen Standards eingehalten werden, unerlässlich. Nur so können zukünftig Qualitätsmanagementprozesse nachhaltig etabliert werden. (Pluta Rechtsanwalts GmbH: ra)
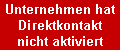
|
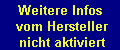
|